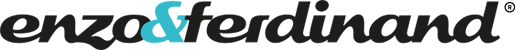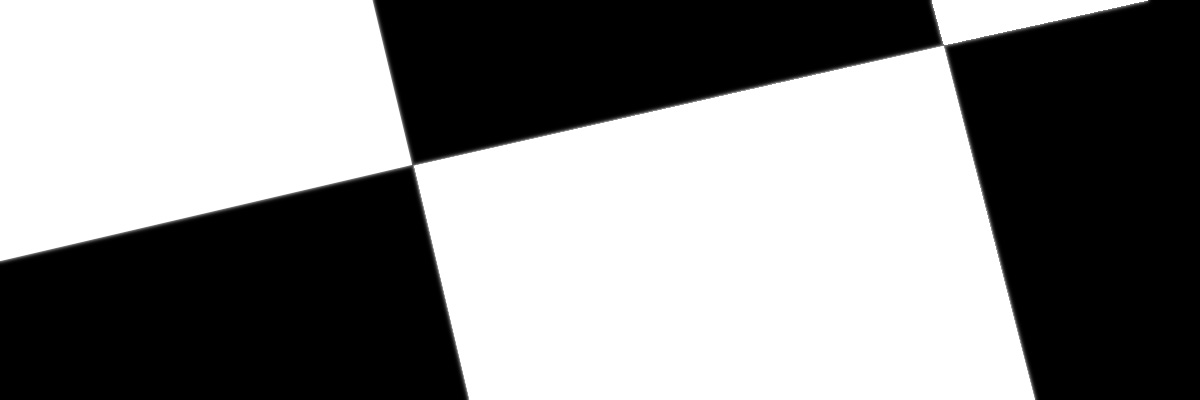Der Rimac C_Two soll mit einer Systemleistung von 1.914 PS und einem aus dem Stand heraus verfügbaren Drehmoment von 2300 Nm das wohl leistungsstärkste elektrische Hypercar der Welt sein. Der viermotorige Antrieb beschleunigt den kroatischen Elektro-Supersportwagen in 1,85 Sekunden von Null auf Hundert und er überschreitet die 300-km/h-Grenze nach 11,8 Sekunden. Zudem nennt der Hersteller eine Reichweite von 550 km, die aus einer Batteriekapazität von 120 kWh gespeist wird.
Was technisch so viel verspricht, bleibt optisch jedoch konventionell. Es stellt sich die Frage, warum noch keiner der Anbieter elektrisch angetriebener Supersportler eine Form entwickelt hat, die den technologischen Systemwechsel adäquat nach außen spiegelt.